
Deutschland zukunftsfest machen
10. Juni 2015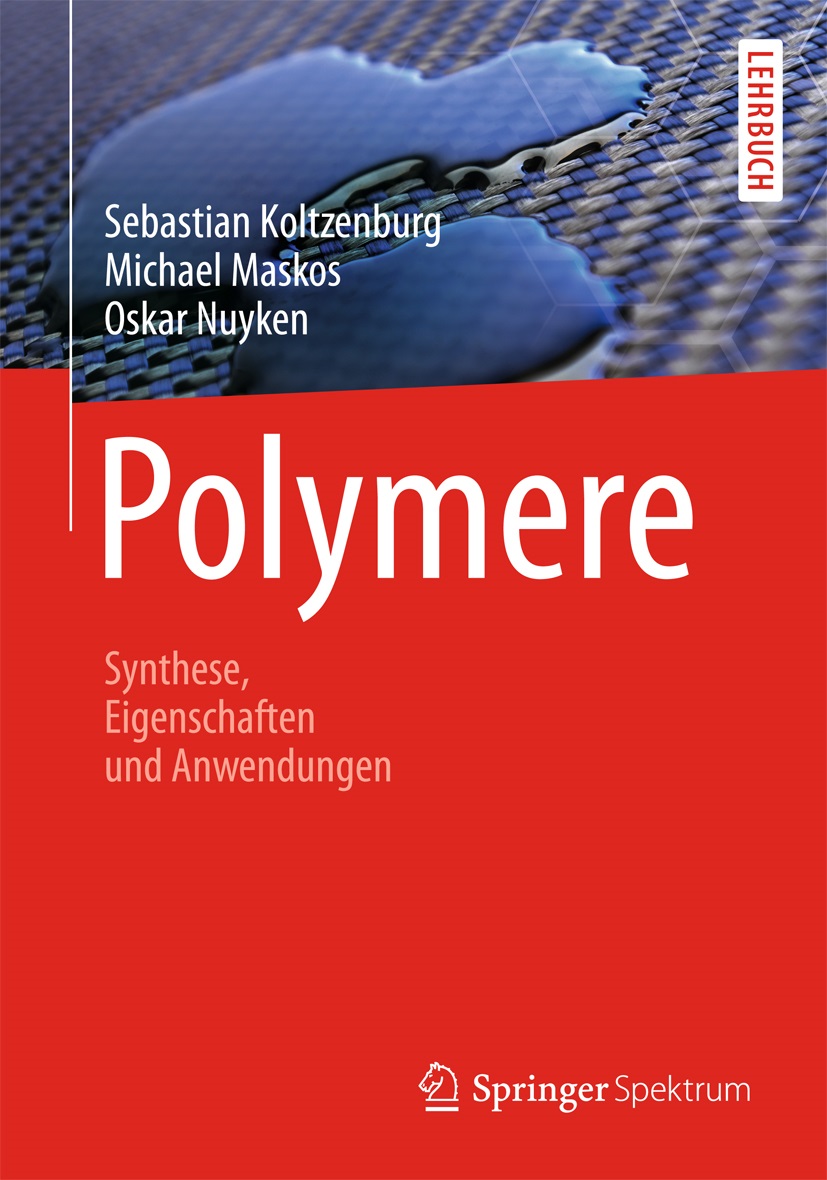
Literaturpreis der chemischen Industrie 2015 für Lehrbuch über Polymere
26. Juni 2015Nanopartikel: Weiche Schale, harter Kern
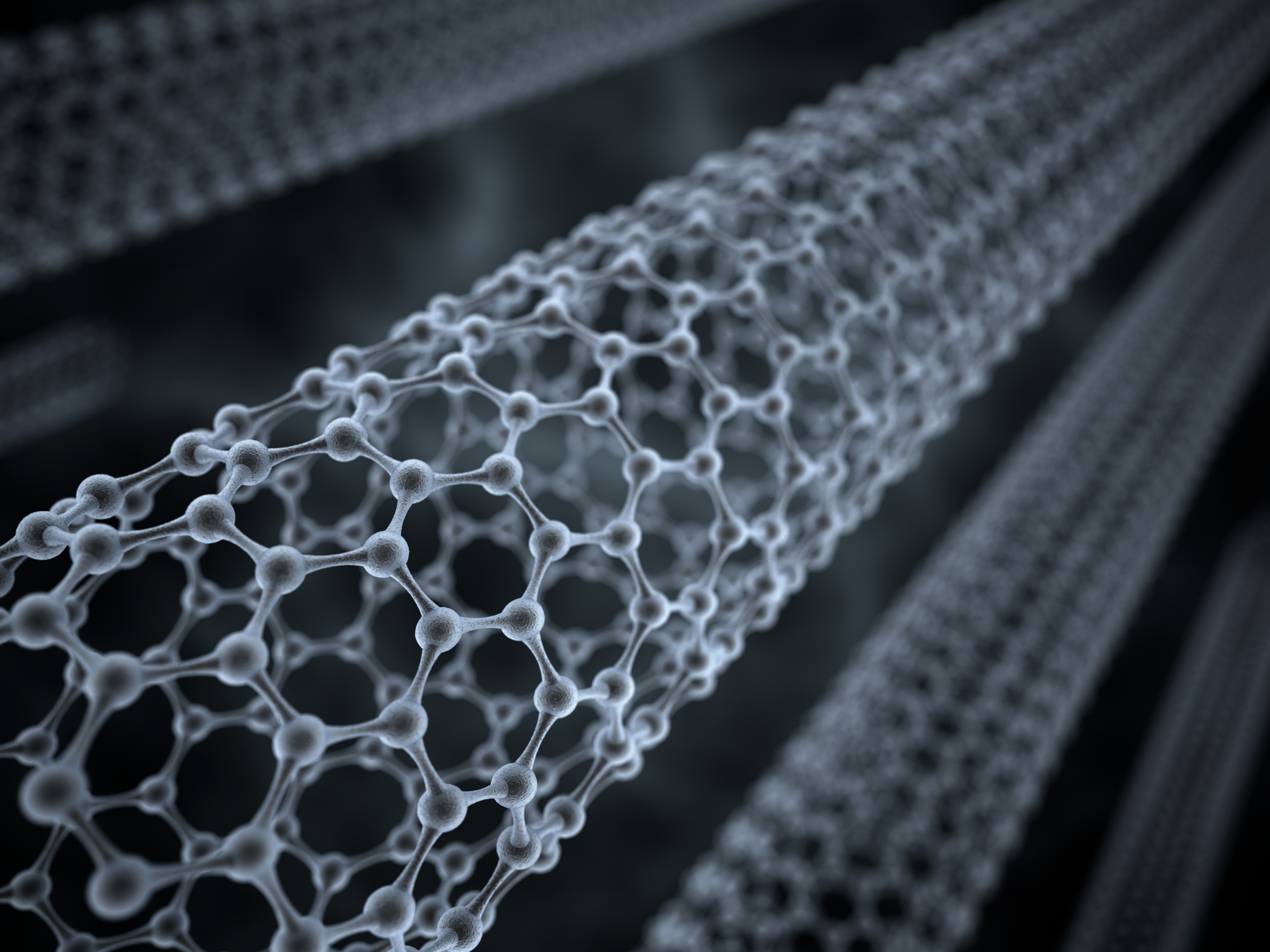
3d Carbon nanotubes on dark background
Auf Nanopartikeln ruhen große Hoffnungen seitens der Medizin, da sie beispielsweise künftig als zielgesteuerte Transportvehikel für Medikamente fungieren könnten. Gemeinsam mit einem internationalen Forscherteam konnten Wissenschaftler des Helmholtz Zentrums München und der Philipps-Universität Marburg nun erstmals die Stabilität und die Verteilung dieser Teilchen im Körper überprüfen. Die in der Fachzeitschrift Nature Nanotechnology veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass die Forschung noch einen langen Weg vor sich hat.
Nanopartikel sind kleinste Teilchen, die bis in entlegene Körperpartien vordringen können. In der Forschung werden verschiedene Ansätze erprobt, wie Nanopartikel medizinisch genutzt werden könnten – beispielsweise um Substanzen an einen speziellen Ort wie etwa einen Tumor zu befördern. Dazu werden sie gewöhnlich mit einer Schicht aus organischem Material bedeckt, denn ihre Oberflächenbeschaffenheit ist entscheidend für ihre weitere Zielbestimmung im Körper. Haben sie etwa eine wasserabweisende Hülle, werden sie schnell vom Immunsystem erkannt und beseitigt.
Wie Goldpartikel durch den Körper wandern
Wissenschaftler um Dr. Wolfgang Kreyling, mittlerweile externer wissenschaftlicher Berater am Institut für Epidemiologie II des Helmholtz Zentrums München, und Prof. Wolfgang Parak von der Philipps-Universität in Marburg, konnten nun erstmals im Tiermodell den zeitlichen Verlauf solcher Partikel nachverfolgen. Dazu konstruierten sie mit einem Gold-Isotop radioaktiv markierte, 5 nm kleine Gold Nanopartikel, die mit einer ebenfalls radioaktiv markierten Polymerhülle ummantelt waren. Laut den Forschern ein handwerklich sehr anspruchsvoller nanotechnologischer Schritt.
Nach der anschließenden intravenösen Injektion mussten sie aber beobachten, wie die extra aufgebrachte Polymerhülle wieder abgebaut wurde: „Überraschender Weise reicherte sich das partikelförmige Gold hauptsächlich in der Leber an“, erinnert sich Kreyling. „Im Gegensatz dazu verteilten sich die Hüllenmoleküle signifikant anders im ganzen Körper.“ Weitere Analysen der Wissenschaftler erklärten, woran das lag: Sogenannte proteolytische Enzyme in bestimmten Zellen der Leber scheinen die Partikeln wieder von ihrer Hülle zu trennen. Dieser Effekt war nach Angaben der Forscher zuvor in vivo nicht bekannt, da die Partikel bislang nur in Zellkulturen getestet worden waren, wo dieser Effekt nicht sorgfältig genug untersucht worden war.
„Unsere Ergebnisse zeigen, dass auch vermeintlich sehr stabile Nanopartikel-Konjugate bei der Anwendung im Körper ihre Eigenschaften verändern können“, ordnet Kreyling die Ergebnisse ein. „Somit wird die Studie sowohl Einfluss auf zukünftige medizinische Anwendungen als auch auf die Risikobewertung von Nanopartikeln in Verbraucherprodukten und in der Wissenschaft und Technik nehmen.“
Originalveröffentlichung:
Kreyling, W. et al. (2015). In vivo integrity of polymer-coated gold nanoparticles, Nature Nanotechnology
Bildquelle: istock-160380750
